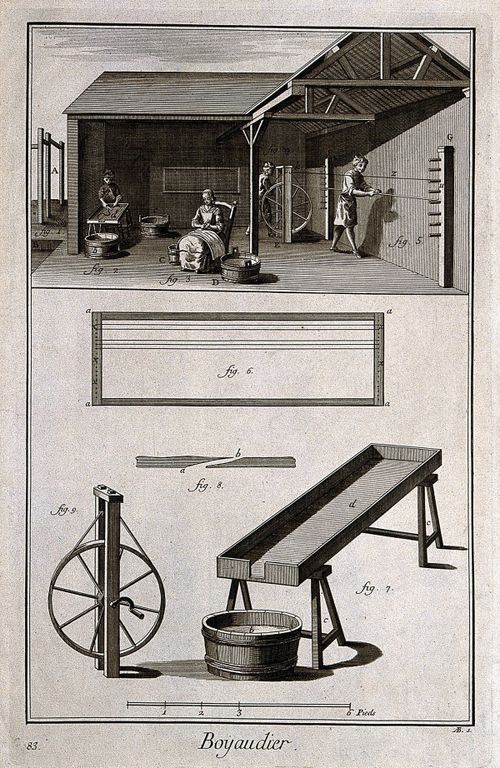Wundinfektionen sind bis weit ins 19. Jahrhundert ein Problem für die Chirurgie. Die meisten Mediziner gehen davon aus, dass Prozesse im Körperinnern den «Brand» verursachen. Erst nachdem die Bakteriologie aufgekommen ist, bringen die Mediziner Infektionen mit Mikroorganismen in Verbindung. Die Krankenhäuser versuchen in der Folge, gegen die Krankheitserreger im Operationssaal vorzugehen. Erst als der Operationsbereich vor dem Einsatz mit Desinfektionsmittel besprüht wird und später die Instrumente und Materialien vorgängig sterilisiert werden, gehen die Wundinfektionen tatsächlich zurück.
«Karbolnebel»
Der britische Mediziner Joseph Lister beschäftigt sich mit der Forschung des Bakteriologen Louis Pasteur und vermutet, dass Mikroorganismen von aussen die Wunden infizieren. Als Konsequenz propagiert er in den 1860er-Jahren erstmals eine keimvermindernde Methode. Dazu entwickelt Lister einen Dampfzerstäuber für das Desinfektionsmittel Karbolsäure. Vor Operationen wird ein «Karbolnebel» im Raum verströmt, der die Krankheitserreger abtöten soll.
Arbeitskleidung
Mit den Bemühungen um Keimverminderung (Antisepsis) und Keimfreiheit (Asepsis) verändert sich auch die OP-Kleidung. Lange operieren Chirurgen in Alltagskleidung – etwa einem dunklen Mantel. Im späten 19. Jahrhundert beginnt das OP-Personal allmählich, weisse Kittel, Handschuhe und Gesichtsmasken zu tragen und sich von seinen Vorgängern abzuheben. Die weisse Farbe bringt jedoch auch Probleme mit sich: Sie blendet und wirkt ermüdend. Die heutigen Farben Grün und Blau verhindern den Nachbild-Effekt von Blutflecken und sollen sogar beruhigend auf Patienten und Patientinnen wirken.
Einwegmaterial
Um das Infektionsrisiko weiter zu senken, greifen die Kliniken seit den 1980er-Jahren verstärkt auf Einweg-Operationssets zurück. Sie enthalten Abdeckungen, OP-Kittel, Gefässe und teilweise sogar Instrumente, die nach der Operation im Abfall landen. Was aus hygienischen Gründen Sinn ergibt, erfährt jedoch angesichts des anfallenden Abfalls auch Kritik.

Sterilisationsanlagen
Um 1900 erweitern die Chirurgen in enger Zusammenarbeit mit der Bakteriologie ihre Massnahmen gegen Wundinfektionen. Sie versuchen, die Krankheitserreger nicht erst im OP-Saal zu beseitigen, sondern von Anfang an fernzuhalten. In Krankenhäusern wie dem Inselspital stehen bald grosse Sterilisationsanlagen zur Verfügung, die Instrumente, Verbandsstoffe und Arbeitskleidung entweder mit trockener Luft oder Wasserdampf sterilisieren. Das Material wird in Metallbehälter gelegt. Die Seitenwände dieser Behälter weisen kleine Öffnungen auf, durch die der Dampf eindringt.